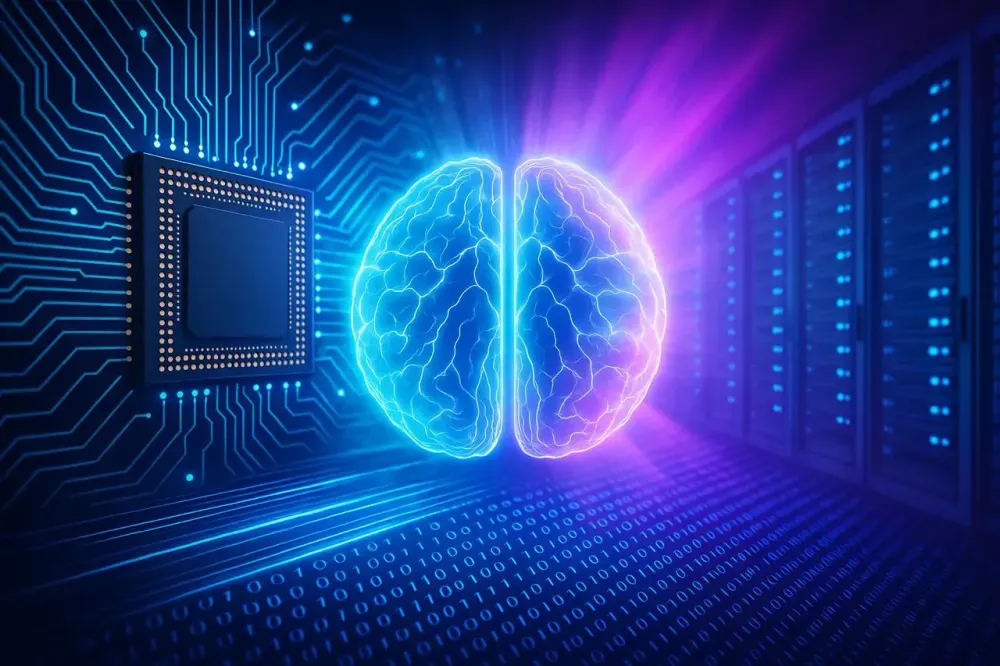Erstens: Profitabilität und Ertragsreife. Viele heutige Marktführer wie beispielsweise die wichtigsten Treiber technologischer Innovationen, die sogenannten Magnificent 7 (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla), erwirtschaften hohe Gewinne und generieren ein klares Ertragswachstum. Dies unterscheidet sie von den zahlreichen Dotcom-Firmen, die damals ohne nennenswerte Gewinne an die Börse gingen. Diese Tatsache eliminiert zwar nicht den Hype, aber reduziert das Risiko, dass es sich allein um eine irrationale Entwicklung handelt.
Zweitens: Bewertungskennzahlen im historischen Vergleich. Betrachtet man typische Bewertungskennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs), lagen die führenden Technologieunternehmen in der Hochphase der Dotcom-Blase (z. B. Microsoft, Cisco, Lucent, Nortel, AOL) bei sehr hohen erwarteten KGVs von über 80. Im Vergleich dazu liegen die Durchschnitts-KGVs der heute dominierenden Unternehmen deutlich tiefer (im Bereich von rund 25–35x, je nach Datenbasis und Zeitpunkt). Diese Einordnung spricht tendenziell dagegen, dass sich der Markt in einer ähnlichen Konstellation befindet wie im Jahr 2000.
Die meisten Portfolios sind in KI übergewichtet – ohne es zu wissen
Dennoch sollten Anleger die Risiken des KI-Booms nicht unterschätzen. Im Jahr 2000 führten Investitionskürzungen, Überkapazitäten und enttäuschende Gewinne zu einem Vertrauensverlust in die «New Economy». Auch bei KI-Aktien besteht kurzfristig das Risiko von Überinvestitionen und Fehlallokationen. Hinzu kommen politische und wirtschaftliche Unsicherheiten. Eine breite Diversifikation bleibt daher entscheidend, um mögliche Rückschläge abzufedern.
Allerdings zeigt sich, dass selbst vermeintlich breit aufgestellte Portfolios inzwischen ungewollt stark gegenüber dem Thema KI exponiert sind. Der rasante Kursanstieg der grossen Technologie- und Chipunternehmen hat dazu geführt, dass viele Indizes – und damit auch passive Anlageformen – eine konzentrierte Allokation in diesem Segment aufweisen. Für Anleger kann dies ein Klumpenrisiko darstellen, das die Diversifikation des Portfolios mindert.