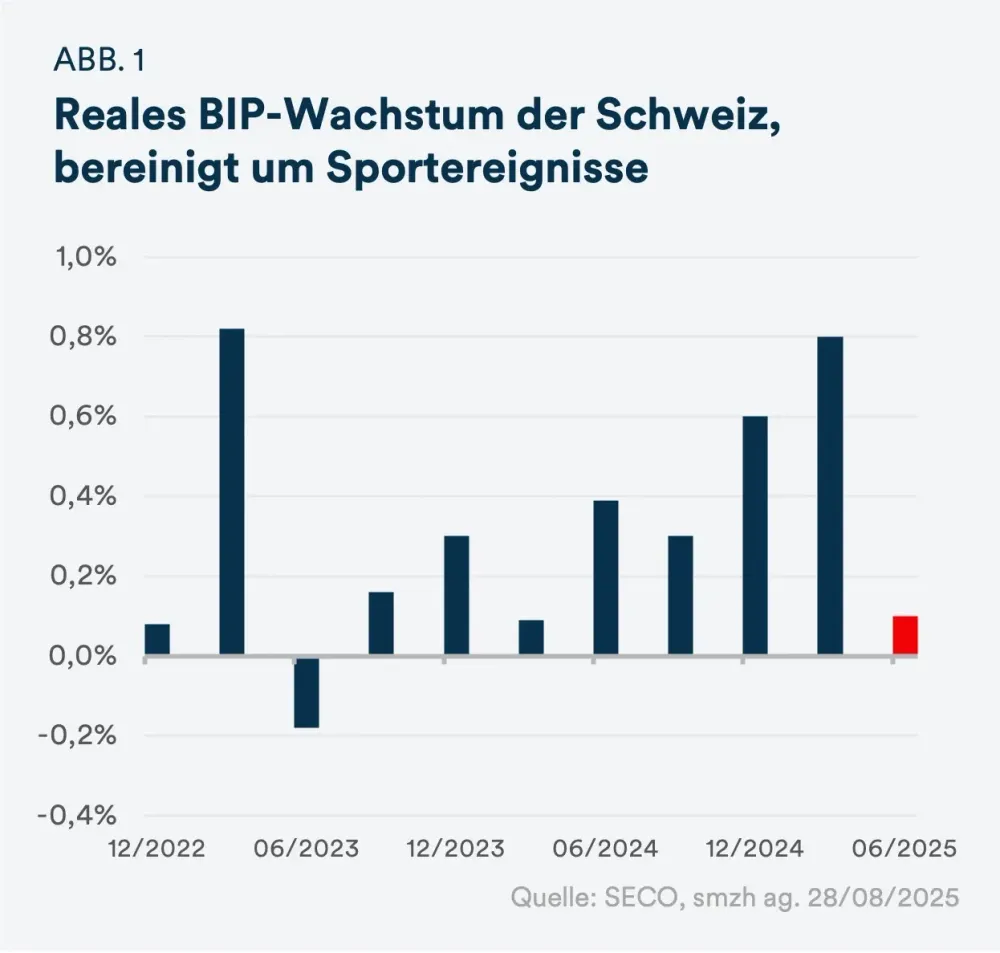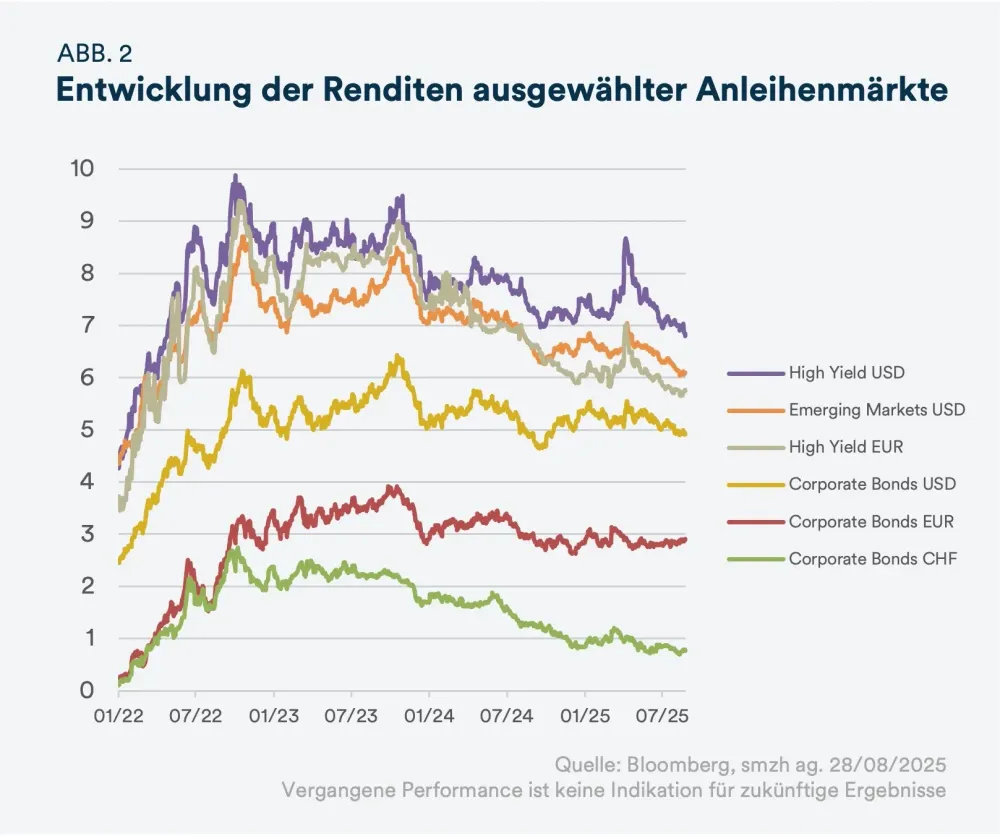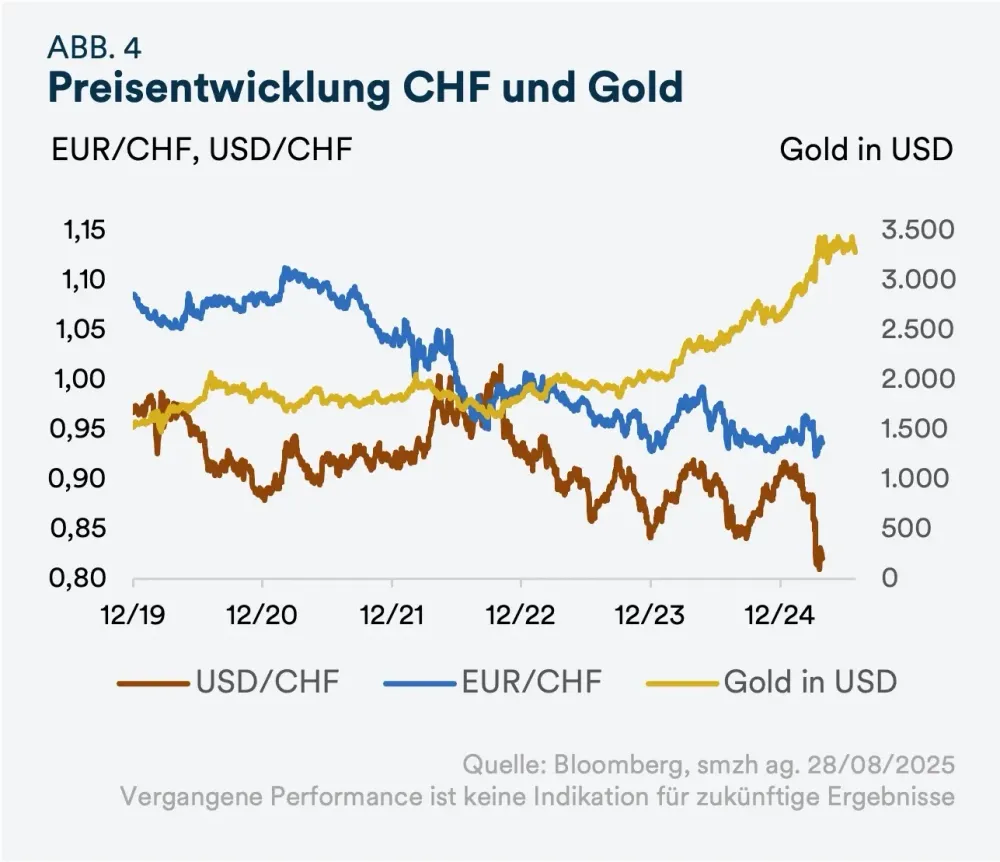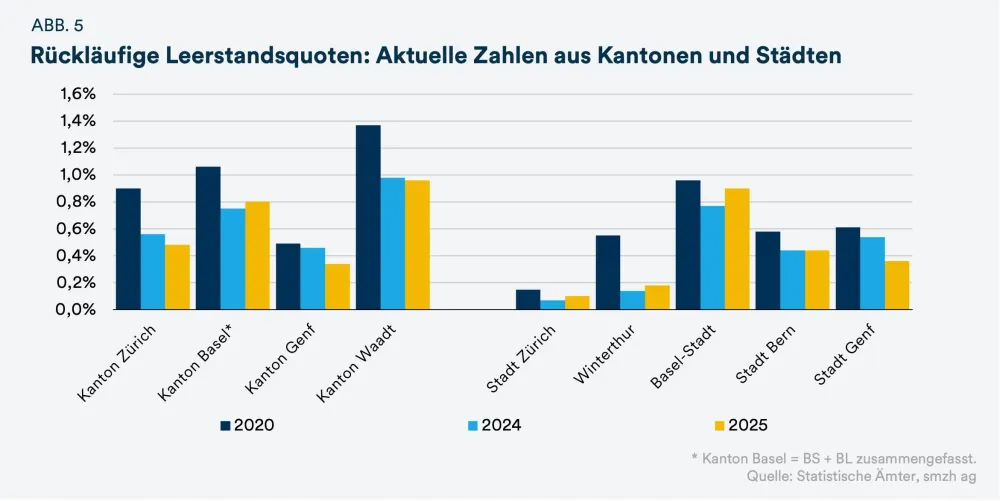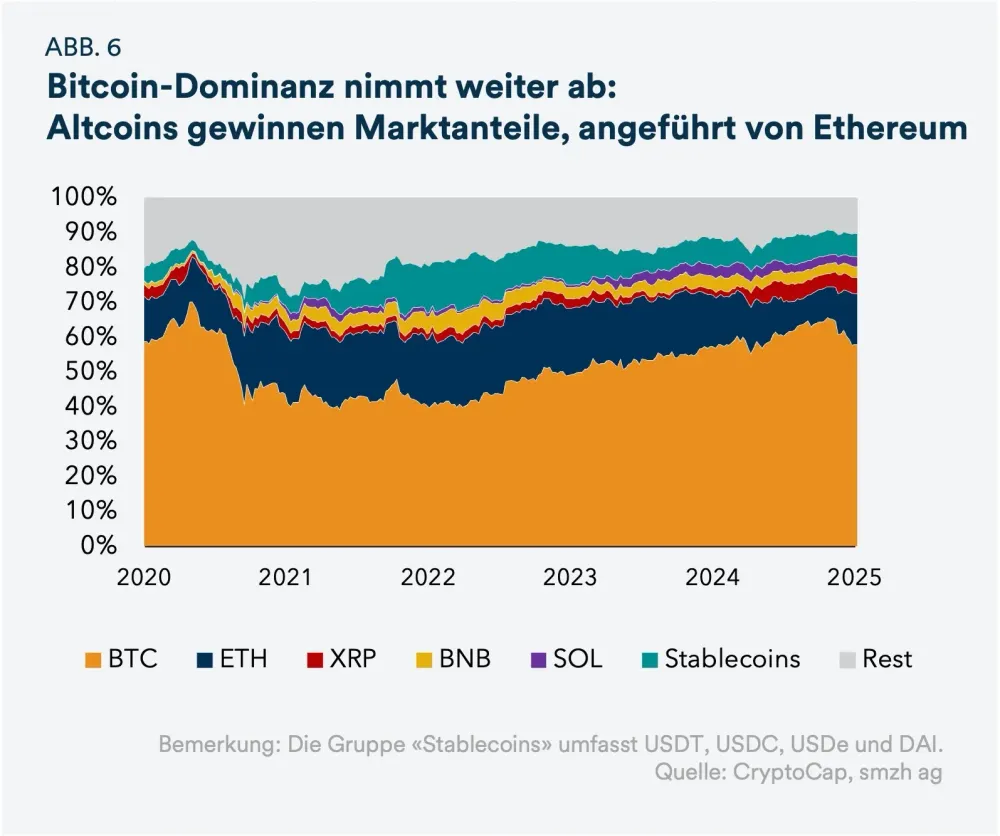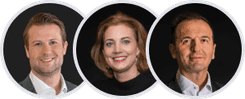Wake me up when September ends
Das Lied «Wake Me Up When September Ends» von Green Day hat im ursprünglichen Kontext für den Lead-Sänger der Band eine zutiefst persönliche Bedeutung und mit den Finanzmärkten keinerlei Verbindung, trotzdem eignet sich der Titel als Metapher für ein weit diskutiertes Phänomen: die Saisonalität an den Märkten und insbesondere der schwache September. Historisch zählt dieser Monat zu den herausforderndsten des Kalenderjahres, was die Überlegung nahelegt, ob es unter Umständen nicht besser wäre, den September «zu verschlafen» und erst im Oktober oder sogar noch später wieder aktiv zu werden. Diese Fragestellung ist aktuell von besonderer Relevanz, da die Aktienmärkte trotz anhaltender geopolitischer Spannungen, handelspolitischer Unsicherheiten und Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum kontinuierlich neue Höchststände erreichen.
Saisonalitäten beschreiben wiederkehrende Muster oder Anomalien, die in bestimmten Zeiträumen auftreten. Bekannte Beispiele sind das Sprichwort «Sell in May and go away» oder die «Santa Claus Rally» zum Jahresende. Seit Jahrzehnten werden solche Anomalien sowohl in der akademischen Forschung als auch in der Marktmeinung von Investoren thematisiert. Die saisonale Marktschwäche im Spätsommer, insbesondere im August und September, gehört zu den auffälligsten Mustern. Daten vieler internationaler Aktienmärkte zeigen, dass die durchschnittlichen Renditen in diesen Monaten oftmals unter dem Jahresmittelwert liegen. Zu den Erklärungsansätzen zählen eine geringere Marktliquidität infolge der Ferienzeit, saisonale Gewinnmitnahmen nach der Ergebnissaison oder Portfolioanpassungen institutioneller Investoren.
Zwischen Statistik und Strategie: Investiert bleiben ist entscheidend, auch bei Marktturbulenzen
Die entscheidende Frage ist, ob solche Muster als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen sollten. Zu den Argumenten, die dagegen sprechen, zählt, dass moderne Märkte effizienter geworden sind und viele der früheren Anomalien durch Arbitrage und algorithmischen Handel abgeschwächt werden. Das Marktgeschehen wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter Wirtschaftsindikatoren, Unternehmensergebnisse, geopolitische Entwicklungen oder geldpolitische Entscheide, die saisonale Effekte überlagern können. So gibt es Jahre, in denen die Märkte in dieser Zeit deutliche Gewinne verzeichnen. Empirische Muster stellen somit keine Garantie dar.
Angesichts der starken Entwicklung der wichtigsten Aktienmärkte seit Jahresbeginn befinden sich die Bewertungen aktuell auf erhöhtem Niveau. In einem von anhaltenden Unsicherheiten geprägten Umfeld könnte eine gesunde Korrektur tatsächlich überfällig sein. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich Anleger vollständig aus Aktien zurückziehen sollten. Trotz erhöhter Risiken bleibt es entscheidend investiert zu bleiben, um die langfristigen Anlageziele nicht zu gefährden.
Für Anleger, deren Aktienquote über dem strategischen Zielwert liegt, können Optimierungsmassnahmen wie Teilgewinnmitnahmen oder Portfolioumschichtungen durchaus sinnvoll sein. Alle anderen dürfen sich von der charmanten Vorstellung inspirieren lassen, einen potenziell turbulenten September einfach auszusitzen und diese Zeit lieber anderen persönlichen Interessen oder längst aufgeschobenen Projekten zu widmen.
Viel Vergnügen beim Lesen.
Freundliche Grüsse,
Gzim Hasani, CEO
Bekim Laski, CFA, Chief Investment Officer