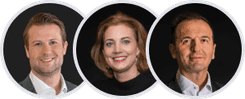Neue Blase oder nachhaltiger Trend?
Der rasante Aufstieg von KI hat die Finanzmärkte in den vergangenen drei Jahren regelrecht elektrisiert. Dieser Boom gilt als einer der Haupttreiber der jüngsten Börsenrally, nicht nur im Technologiesektor. Der Enthusiasmus rund um generative KI, maschinelles Lernen und cloudbasierte Rechenleistung hat Investoren weltweit beflügelt, aber auch die Bewertungen der Unternehmen und der breiten Aktienmärkte deutlich in die Höhe getrieben. Damit drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob die aktuellen Kursniveaus noch durch die Fundamentaldaten gerechtfertigt sind oder ob wir uns erneut in einer spekulativen Blase befinden, wie zur Zeit der Dotcom-Ära um die Jahrtausendwende.
Tatsächlich lassen sich gewisse Parallelen kaum leugnen: Euphorie um eine bahnbrechende Technologie, enorme Kursgewinne innerhalb kurzer Zeit und ein wachsender Glaube, dass ein struktureller Wandel ganze Branchen neu definieren könnte. Und doch bestehen wesentliche Unterschiede, die darauf hindeuten, dass der KI-Boom auf einem deutlich solideren Fundament ruht. Die heute dominierenden Akteure, die sogenannten «Magnificent 7» (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla), sind im Gegensatz zu vielen der verlustreichen Internet-Start-ups von 1999 hochprofitabel, etabliert und kapitalstark. Sie verfügen über bewährte Geschäftsmodelle, eine starke Cashflow-Basis und teils marktbeherrschende Positionen in ihren Segmenten.
Während viele Technologieaktien im Jahr 1999 mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGVs) von über 70 oder gar 100 gehandelt wurden, liegen die Multiplikatoren der heutigen Marktführer im Bereich von 25 bis 35. Die aktuelle Bewertung reflektiert also zwar hohe Erwartungen, bewegt sich aber in einem Rahmen, der durch reale Gewinne und Cashflows unterlegt ist.
Letztlich unterscheidet sich auch die Natur der zugrunde liegenden Innovation. Die heutige KI-Welle hat nicht nur spekulativen Charakter, sondern basiert auf einer greifbaren technologischen Revolution: Rechenzentren, Halbleiter, Cloud-Infrastrukturen und KI-Software bilden einen realwirtschaftlichen Wertschöpfungskomplex mit erheblichen Investitionsvolumina. Der Boom ist somit nicht allein ein Kapitalmarktphänomen, sondern Ausdruck eines tiefgreifenden technologischen Paradigmenwechsels mit Anwendungspotenzial quer durch sämtliche Branchen, von Medizin über Industrie bis hin zu Finanzdienstleistungen.
Verborgene Konzentrationsrisiken
Allerdings sind auch die Risiken nicht zu unterschätzen. Die enorme Marktkonzentration der «Magnificent 7» birgt Klumpenrisiken: Diese Unternehmen machen mittlerweile rund 35% der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500-Index und über 22% des globalen Aktienindex MSCI All Country World Index aus. Enttäuschungen bei nur einem dieser Schwergewichte könnten den Gesamtmarkt erheblich belasten. Viele Portfolios, die entlang der etablierten Aktienindizes investiert und vermeintlich breit diversifiziert sind, weisen tatsächlich eine starke Ausrichtung auf wenige Wachstumstreiber auf. Denn Standardindizes, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, werden inzwischen von KI-bezogenen Mega-Caps dominiert. Für Anleger bedeutet dies, dass eine regelmässige Überprüfung der eigenen Portfoliostruktur daher essenziell bleibt, nicht etwa aus Skepsis gegenüber KI, sondern um ein ausgewogenes und widerstandsfähiges Portfolio zu gewährleisten.